Schweizerischer Extrazug unter dem Druck fundamentalistischer Opposition?
In der Sommerferienzeit füllen die Medien eine gewisse Leere der Ereignisse auch gerne mit rezykliertem Stoff aus vergangenen Zeiten. Da mein Blog schon seit 2012 existiert, war die Versuchung gross, auch auf frühere Beiträge zurückzugreifen. Es könnte doch interessant sein zu sehen, ob damalige politische Themen weiter aktuell sind. Sind in der Zwischenzeit Lösungen gefunden worden oder kämpfen wir immer noch gegen die gleichen Widerstände an wie damals?
GVO in der Landwirtschaft – fast ewig aktuell
Also ging ich auf die Suche nach Artikeln aus der Anfangszeit des Blogs. Dort fand ich bald einen Beitrag vom April 2013 mit aktuellem Bezug. Unter dem Titel „Die Illusion objektiver Staatsmedien“ hatte ich am umstrittenen Thema der Grünen Gentechnik gezeigt, dass Objektivität bei den staatlich eingerichteten Medien nur eine politische sein kann, nicht aber eine sachlich-wissenschaftliche. Politische Objektivität bedeutet, dass die öffentlich-rechtlichen Medien die Pflicht haben, das reale politische Meinungsspektrum unparteiisch abzubilden, so wie es sich zum Beispiel aufgrund der Parteistärken zeigt. Eine solche Objektivität kann aber durchaus mit einer sachlich-wissenschaftlichen Objektivität in Konflikt stehen.
Der Aktualitätsbezug beim Thema der gentechnisch veränderten Organismen (GVO) in der Landwirtschaft ist zweifach. Erstens läuft das schon vier Mal verlängerte GVO-Moratorium dieses Jahr aus. Der Bundesrat schlägt eine Verlängerung um weitere fünf Jahre vor. Zweitens steht eine spezielle Gesetzesregelung für die innovative „Genschere“-Technologie an, die von den einschlägig bekannten lautstarken GVO-Gegnern fundamentalistisch abgelehnt wird.
Geschichte des GVO-Moratoriums
Seit 2005 gibt es das GVO-Moratorium. Es wurde durch eine Volksinitiative eingeführt, die der Bundesrat und das Parlament damals sachlich begründet ablehnten. Zum Moratorium liest man auf „News Service Bund“, dem Portal der Schweizer Regierung: „Unter dem Gentechnik-Moratorium dürfen keine Bewilligungen für das Inverkehrbringen von gentechnisch veränderten Pflanzen und Pflanzenteilen, gentechnisch verändertem Saatgut und anderem pflanzlichen Vermehrungsmaterial sowie gentechnisch veränderten Tieren zu landwirtschaftlichen, gartenbaulichen oder waldwirtschaftlichen Zwecken erteilt werden. In der Schweiz dürfen diese gentechnisch veränderten Organismen nur zu Forschungszwecken bewilligt werden. Das Moratorium gilt inhaltlich unverändert seit der Annahme der Volksinitiative “für Lebensmittel aus gentechnikfreier Landwirtschaft“ im Jahr 2005.“
Fortschrittssprung bei der Grünen Gentechnik: Die „Genschere“
Seit April 2013 hat die Grüne Gentechnik einen grossen Entwicklungssprung gemacht. Dieser müsste eigentlich die Anti-GVO-Fundamentalisten besänftigen, wenn sie sich an das berühmte Diktum des berühmten Ökonomen John Maynard Keynes halten würden, der einmal gesagt haben soll: „Wenn die Fakten ändern, ändere ich meine Meinung“. Nun ist es aber gerade das Kennzeichen von Fundamentalisten, dass Fakten ihrem missionarischen Furor nichts anhaben können.
Die „Genschere“ nach Google Gemini
Im Kontext der grünen Gentechnik, die sich mit Pflanzen beschäftigt, bedeutet das, dass Wissenschaftler mit dieser „Schere“ ganz präzise das Erbgut von Pflanzen verändern können. So können sie beispielsweise:
Pflanzen widerstandsfähiger machen: Indem sie Gene entfernen, die eine Pflanze anfällig für Schädlinge oder Krankheiten machen, oder neue Gene hinzufügen, die ihr Schutz bieten.
Ernteerträge verbessern: Indem sie Gene anpassen, die das Wachstum oder die Fruchtbildung beeinflussen.
Nährwert erhöhen: Indem sie Pflanzen so verändern, dass sie mehr Vitamine oder andere wertvolle Inhaltsstoffe produzieren.
Das Besondere an der Genschere ist ihre Präzision. Im Gegensatz zu älteren Gentechnik-Methoden, bei denen Veränderungen eher zufällig im Erbgut platziert wurden, kann die Genschere punktgenau an der gewünschten Stelle ansetzen. Das macht die Ergebnisse vorhersehbarer und sicherer. Kurz gesagt: Die Genschere ist ein zielgerichtetes Werkzeug, mit dem man das Erbgut von Pflanzen sehr genau bearbeiten kann, um ihnen gewünschte Eigenschaften zu verleihen.
UVEK-Vorsteher Rösti will das GVO-Moratorium ein weiteres Mal bis ins Jahr 2030 verlängern. Er hofft, fünf Jahre könnten genügen, um im Dickicht der höchstpartizipativen eidgenössischen Institutionen seinen Gesetzesvorschlag zur speziellen Regelung der neuen „Genschere“-Technologie durchzubringen. Der vorliegende Entwurf ist allerdings restriktiver als das, was die EU bezüglich „Genschere“ vorhat. In einem Gastkommentar in der NZZ vom 23. Juli kritisierte Urs Niggli unter dem Titel „Die Genschere revolutioniert auch den biologischen Pflanzenschutz“ diese schweizerische Sonderregelung als in mehrfacher Hinsicht schädlich (hier). Ein solches Regime sei auch volkswirtschaftlicher Unsinn. Diese Stimme zählt, denn Niggli war langjähriger Direktor des Forschungsinstituts für biologischen Landbau (Fibl).
Angst vor Referenden und Volksinitiativen
Weshalb also meint der Bundesrat, die Schweiz brauche hier eine restriktivere Sonderregelung? Die Antwort ist einfach, und ich hatte sie in meinem Kommentar zu Nigglis Artikel in der NZZ so formuliert: „Weil der Druck der direkten Volksrechte wirkt: Angst vor Referenden und Volksinitiativen mit dem Resultat, dass die Politik immer wieder überschiessende Konzessionen an lautstarke Minderheiten macht, welche systematisch Desinformation verbreiten…“

Bisher verwiesen die Behörden bei jeder Verlängerung des Moratoriums auf die Chance, die Zeit für weitere Abklärungen über den Einfluss von GVO in der Landwirtschaft auf Mensch und Umwelt zu gewinnen. Dieses Mal sollen die fünf Jahre Verlängerung genügen, um die neue „Genschere“-Technologie gesetzlich separat zu regeln. Eine solche Zeitvorgabe illustriert eindrücklich, mit was für massiven Widerständen, endlosen Diskussionen, Anhörungen und Vernehmlassungen im schweizerischen Institutionengeflecht gerechnet werden muss.
Alles, was man zur grünen Gentechnik im Hinblick auf eine gesetzliche Regelung wissen muss, ist längst bekannt. Im Jahr 2012 bestätigte das Nationalfonds-Projekt NFP59, das über 1’000 weltweit verfügbare Studien auswertete, den Stand der Forschung: Der Nutzen der grünen Gentechnik ist sowohl generell wie auch für die schweizerische Landwirtschaft erwiesen, und die Risiken sind nicht grösser als bei konventioneller Züchtung. Inzwischen hat der technologische Fortschritt frühere Einwände gegen die Grüne Gentechnik noch obsoleter gemacht. Ins Bild passt, dass ausgerechnet die organisierten Anti-GVO-Interessen, die am lautesten vor der „Klimakrise“ und sinkenden Ernteerträgen warnen und den übermässigen Gebrauch von Pestiziden anprangern, den Nutzen der „Genschere“ In Bezug auf diese Problemfelder ignorieren.
Mutloser Bundesrat
Schon aus diesem Grund ist es unverständlich, dass der zuständige Bundesrat und ETH-Agrarökonom (!) Rösti mit seinem doppelt mutlosen Verhalten (Verlängerung des Moratoriums um fünf Jahre und restriktiver Gesetzesentwurf) den GVO-Gegnern in die Hände spielt. Er vermittelt der Öffentlichkeit damit, über die Grüne Gentechnik seien noch nicht alle Risiken ausgeräumt, auf denen die militanten GVO-Gegner gerne herumreiten. Man könnte doch erwarten, dass ein Bundesrat die Öffentlichkeit auch einmal mit Sachinformationen aufzuklären versucht, statt schon alle möglichen Widerstände präventiv in einen Gesetzesentwurf einzubauen.
Dass die einschlägig bekannten Anti-GVO-NGO gegen ein Spezialgesetz für die „Genschere“-Technologie auf die Barrikaden steigen, hat vor allem auch damit zu tun, dass sie ihr Machtinstrument des Verbandsbeschwerderechts in Gefahr sehen. Im geltenden Gesetz ist dieses verankert. In einem neuen Gesetz wird es im Parlament sicher zu einer Debatte über den Verzicht auf das Verbandsbeschwerderecht kommen. Die Anti-GVO-Aktivisten fordern deshalb, dass für die „Genschere“ auch das bestehende Gesetz gilt. Es ist sehr eigenartig, dass sich ausgerechnet solche Menschen selbst als Progressive sehen, nicht zuletzt, weil sie von vielen Medien immer wieder bestätigend als solche etikettiert werden. Doch diese heutigen Progressiven sind nicht mehr wirklich progressiv im eigentlichen Sinne des Wortes, jedenfalls weit entfernt von der progressiven Haltung der Mitte des 20. Jahrhunderts, die den technologischen Wandel als Wegbereiter für Wohlstand und Freiheit begrüsste.
(Dieser Beitrag wurde am 25. Juli 2025 im Blog des Autors “Voll daneben” publiziert.)
Vielen Dank für das Teilen und Verbreiten dieses Artikels!
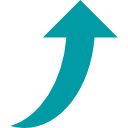
Schon die Sowjetpropaganda nannte diejenigen, die keine Weiterentwicklung wollten, “progressiv”.
Wenn ich das Wort nur schon höre, denke ich unwillkürlich an einen arroganten Ewiggestrigen, der irgend eine längst widerlegte Meinung aus dem Abfallkübel der Geschichte geholt hat, sie nicht versteht, aber sich etwas darauf einbildet.
An sich ist es einfach:
dank Genschere gesund sein oder an Pestiziden krepieren?
Die “Progressiven” wollen das zweite.